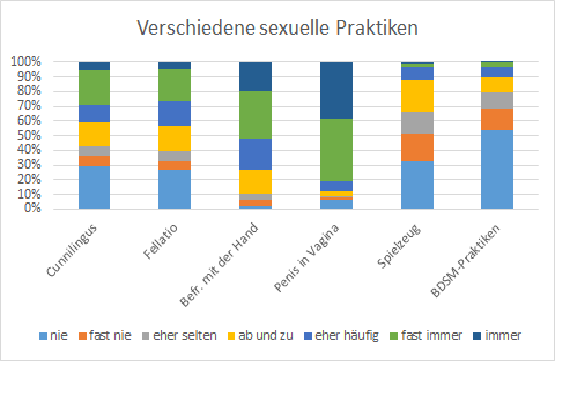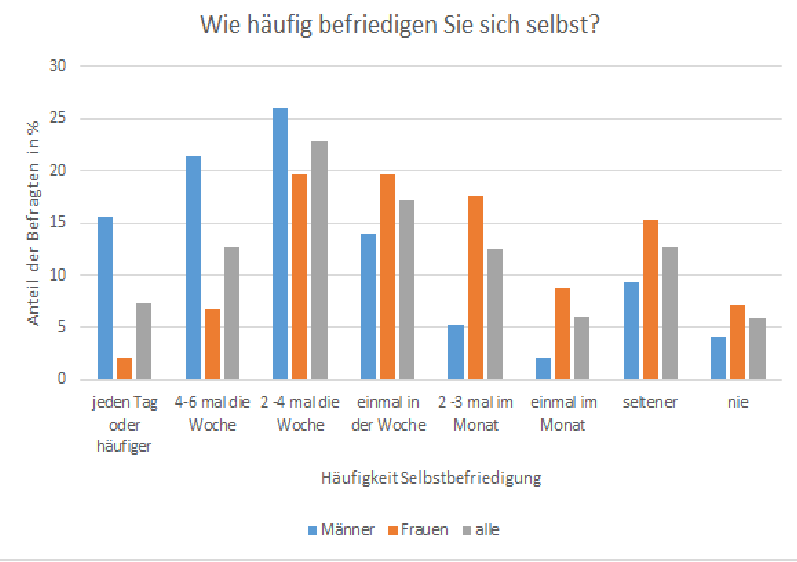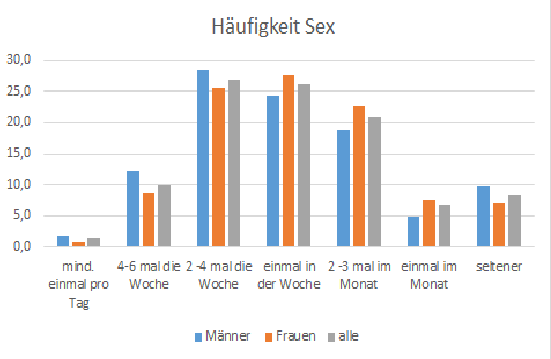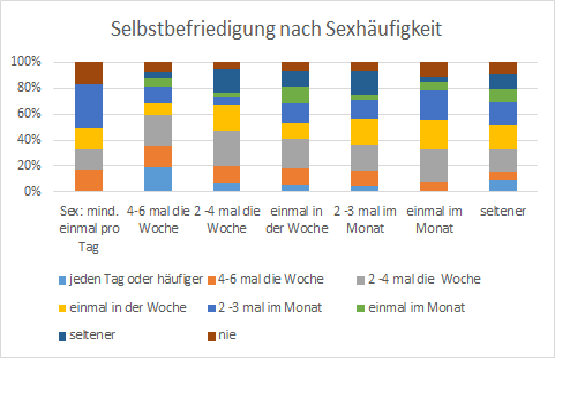Die wunderbare Sara Ablinger hat mich eingeladen mit ihr und zwei weiteren spannenden Menschen – dem Playfight-Experten und Künstler Dorian Bonelli und der Jugend-Aufklärerin und Psychologin Elisabeth Mayer – über Konsens zu diskutieren. Ich hatte mir vorher überlegt, was für mich Konsens ist und vor allem was meine Ansicht nach die Bedingungen für Konsens sind.

von rechts nach links: Dorian, Kathrin, Sara und Elisabeth bei der Podiumsdiskussion zum Thema Konsens; Bilder: Daniel Nuderscher
Hier möchte ich diese Punkte, gemeinsam mit dem was ich von den anderen Diskussionsteilnehmer*innen gelernt habe, zusammenfassen und zur Diskussion stellen. Zunächst mal:
Was ist eigentlich Konsens?
Im Englischen wird in Diskussionen zur Einvernehmlichkeit von Berührungen und Sex oft das Wort ´consent` verwendet, das soviel wie Einwilligung bedeutet. Wahrscheinlich deswegen wird auch im deutschen Sprachraum Konsens oft als ein Vorgang verstanden, in dem eine Person etwas möchte, in das die andere dann (explizit) einwilligt. Dieses Konzept ist aus mehreren Gründen problematisch. Wenn wir an die Person denken, die den Konsens einholt oder einholen sollte, denken wir oft an einen Mann und wenn wir an die Person denken, die zustimmt, dann denken wir an eine Frau. Wenn wir Konsens so unkritisch auffassen, reproduzieren wir also häufig heteronormative und sexistische Klischees. Männer sind dann die, die immer wollen (und deswegen nicht gefragt werden müssen) und Frauen die, für die Sex potentiell unangenehm und eine Bedrohung ist.

Bild: Daniel Nuderscher
Interessanterweise hat das Wort Konsens im Deutschen aber noch eine zweite Bedeutung: wenn verschiedene Parteien zu einem Konsens kommen, finden sie gemeinsam und gleichberechtigt einen Weg, der für alle passt. Und genau das wünschen wir uns ja im Grunde, wenn sich Menschen berühren oder Sex miteinander haben. Ich finde es deswegen sehr wichtig, dass wir in der Diskussion um Einvernehmlichkeit nicht (nur) in Kategorien von consent denken sondern uns anschauen wie echter Konsens ausschauen kann.
Was aber sind Voraussetzungen für Konsens?
(1) Selbstkonsens: Um sagen zu können, was ich (nicht) will, muss ich wissen was ich will (und was nicht). Und muss mir das auch zugestehen. Klingt einfach, ist es aber oft nicht. Wie oft übergehen wir ein ungutes Gefühl oder lassen uns auf etwas ein, was wir eigentlich nicht wollen, um nett zu sein oder eine andere Person nicht zu kränken? Aus der Diskussion habe ich gelernt, dass es für viele Menschen in Ordnung ist, sexuell auch mal etwas für andere zu tun, worauf sie gerade nicht so Lust haben, eben um der anderen Person einen Gefallen zu tun. Wir waren uns aber einig, dass die andere Person das wissen muss, sonst ist es kein echter Konsens. Außerdem wurde die Frage diskutiert, ob wir ganz grundsätzlich überhaupt von einem freien Willen ausgehen dürfen oder ob nicht das, was wir wollen, von Umständen und Erfahrungen beeinflusst bzw. determiniert ist. Ich habe dazu eine klare Position. Ich denke aber, dass wir, selbst wenn wir den freien Willen in Frage stellen, doch nicht in Frage stellen würden, dass Menschen etwas nicht wollen können.
(2) Die Einsicht, dass Konsens keine einmalige Angelegenheit ist: Ansätze, die Konsens im Zusammenhang mit Sexualität gesetzlich regeln wollen (was ich grundsätzlich keine schlechte Idee finde), haben oft das Problem, dass Sex als eine abgegrenzte und definierte Handlung aufgefasst wird, in die man einmal einwilligen kann und die dann abläuft wie ein Film. Also eine Person sagt “darf ich Dich küssen” oder “willst Du mit mir schlafen” und dann gilt das enthusiastische Ja, das da dann immer eingefordert wird, für alles Folgende. Solche Konzepte setzen voraus, dass es feste Regeln und Skripte davon gibt, was dann zu folgen hat. Das empfände ich als sehr einschränkend: Guter Sex ist kein einstudiertes Theaterstück sondern idealerweise etwas, was sich zwischen Menschen immer wieder neu und immer wieder anders entwickeln kann. Konsens sollte dann nicht nur am Anfang sondern immer wieder und nicht zuletzt in Bezug auf sein Ende hergestellt werden. Denn guter Sex kann gut enden lange nachdem beide zum Höhepunkt gekommen sind – oder auch lange davor.
(3) Elisabeth Mayer hat an einem Punkt der Diskussion einen schönen Satz gesagt: Konsens muss nicht immer verbal sein aber er muss es potentiell sein können. Warum und was ist damit gemeint? Wenn Konsens ein fortlaufender Prozess ist, dann fänden wir es wohl alle ziemlich nervig, wenn er immer wieder explizit verbal hergestellt werden müsste. Und – da waren sich interessanterweise auch alle einig in der Diskussionsrunde – das muss er auch nicht. Wir verfügen über nonverbale Wege, Einverständnis herzustellen, und sich mit voller Aufmerksamkeit auf das Gegenüber zu konzentrieren kann schon sehr dabei helfen, zu spüren, was die andere Person braucht. Doch nicht immer gelingt das nicht-verbal – und das ist weder ein Versagen noch ein schlechtes Zeichen. In solchen Situationen ist es aber wichtig, dass beide ohne falsche Zurückhaltung oder Scham sagen können, was nicht gut ist oder was sie stattdessen gerne anders hätten. Und solche Gespräche gelingen vor allem, wenn man sie in “guten Zeiten”, dann wenn es gerade kein Problem gibt, geübt hat, was mich direkt zum nächsten Punkt bringt.
(4) Wir brauchen eine Sprache für Sex. Um darüber sprechen zu können, was wir mögen und was nicht, was wir uns wünschen und wovon wir phantasieren, müssen wir in der Lage sein, ohne Scham über Körperteile, Berührungen und sexuelle Handlungen zu sprechen. Das ist nicht leicht in einer Zeit und einer Sprachgemeinschaft in der jedes alltäglich gebrauchte Wort für die weiblichen Geschlechtsorgane entweder eine Verniedlichung ist oder als Schimpfwort gebraucht wird. Und es ist nicht leicht, weil unsere Sprache über Sex entweder pornoesk oder medizinisch ist und ein normales “Dazwischen” fehlt (hier habe ich schonmal darüber geschrieben). Um im Zweifelsfall Konsens verbal herstellen zu können, wäre aber genau so eine normale Sprache sehr hilfreich Und die können wir bereits im Alltag einüben.
(5) Wir müssen uns bewusst sein, inwiefern Macht Konsens beeinträchtigen kann. Ich sage hier bewusst nicht, dass jedes noch so kleine Machtgefälle Konsens unmöglich macht. Das würde den Personen mit der geringeren Macht zusätzlich Handlungsmöglichkeiten absprechen und sie damit bevormunden. Es ist aber auch klar, dass ich nicht so leicht Nein sagen kann, wenn ich psychisch oder ökonomisch von eine Person abhängig bin. Ich halte es deswegen durchaus für sinnvoll, dass Sex zwischen Therapeut*ìnnen und Klient*innen verboten ist und Lehrer*in-Schüler*in-Paare mit dem Sex warten bis die letzte Prüfung beurteilt ist (oder überhaupt einen Lehrer*innen-Wechsel anstreben). Ähnliches gilt für den beruflichen Kontext, wenn ein Machtgefälle besteht.

Dorian Bonelli Bild: Daniel Nuderscher
(6) Berührung kann Konsens schaffen. Dorian Bonelli hat eines der überraschendsten und interessantesten Statements des Abend gemacht: um zu Konsens zu kommen, sollen wir in Berührung bleiben. Das überrascht deswegen, weil wir Berührung oft mit Grenzüberschreitung verbinden und wir doch eigentlich Konsens herstellen sollten, bevor wir uns berühren, oder nicht? Um das Statement besser zu verstehen, muss man vielleicht wissen, dass Dorian Playfights veranstaltet, also “Spielkämpfe” bei denen die Teilnehmer*innen vorher wissen, dass sie kämpfen werden, also berühren werden und berührt werden. Sein Statement bezog sich aber durchaus auf einen weiteren Rahmen und ich habe das zwar noch nicht ganz durchdacht, aber intuitiv würde ich ihm zustimmen, was sicher auch mit (3) zu tun hat: Konsens muss nicht immer verbal hergestellt werden. Ich denke dass wir es in einer berührungslosen Gesellschaft noch schwerer haben, zu Konsens zu kommen.
(6) Wir müssen bereit sein, ein Nein dankbar anzunehmen. Dieser schöne Gedanke kam von Sara, die das in ihren Workshops aktiv üben lässt: sich ein Nein abholen und dieses mit einem Danke anzunehmen. Ich habe das selbst mal in einem Workshop ausprobiert: wir sollten unser Gegenüber so berühren, dass es irgendwann Nein sagt. Ich habe mich vor dieser Übung ziemlich gefürchtet, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Zurückweisung umgehen würde. Es war aber dann gar nicht schwer: weil ich realisiert habe, dass das Nein nicht mir als ganzer Person gilt sondern nur einer meiner Handlungen. Und dass es nicht die Interaktion/Beziehung insgesamt beendet sondern nur diese eine Handlung. Und dann konnte ich es als wertvolle Information begreifen, mich bedanken, dass die Person den Mut hatte Nein zu sagen und damit etwas sehr wichtiges dazu beigetragen hat, dass unsere Beziehung konsensuell bleibt. Das ganze funktioniert aber auch andersherum: wenn wir einem Nein mit einem Danke begegnen, dann wird es nicht so schnell zur Bedrohung für unseren Selbstwert und wir tragen insgesamt zur einer Kultur des Konsens bei.
Ich denke, dass das alles nicht leicht ist. Und es kann immer wieder vorkommen, dass es da zu Unklarheiten und Missverständnissen kommt. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass uns versprochen wird, dass es leicht ist. Und dass wir deswegen glauben (oder glauben gemacht werden) es bräuchte keine Auseinandersetzung über Konsens. Wir waren uns am Ende der Diskussion einig, dass es die nach wie vor braucht und vielleicht immer brauchen wird.

Danke an Sara, Elisabeth und Dorian für die wertvollen Inputs; Bild: Daniel Nuderscher
Wie geht es Euch mit Konsens? Wart Ihr schon in Situationen, in denen Ihr Euch nicht sicher wart, ob sie konsensuell sind? Und habt Ihr schonmal von Berührungen Abstand genommen, weil Ihr nicht wusstest, wie ihr Konsens herstellen könnt?