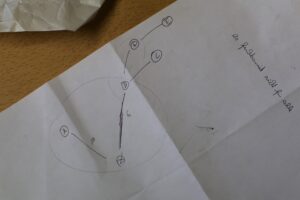In der Serie ‘Sexualities’ werden hier in im Folgenden immer wieder Menschen zu Wort kommen, die über ihre ungewöhnliche oder auch sehr gewöhnliche Sexualität berichten werden: Nicht in Form einer (medizinischen) Fallgeschichte, also aus einem pathologisierenden Blickwinkel, sondern als Bericht von und über sexuelle Vielfalt und Individualität. – Ein wenig auch als Gegenpol zu einer sozialwissenschaftlichen Sichtweise, die in der Regel auf bestimmte Menschengruppen gerichtet ist statt auf Einzelfälle. Fabian Ventura macht den Anfang: er hat sich für die Form des Interviews mit sich selbst entschieden.
Ich sitze mit mir selbst, einem Laptop und – im Laufe der Zeit – mehreren Tassen guten Espresso in einem Café. Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe: ein Interview mit mir selbst über meine Sexualität. Nun, immerhin kenne ich mich zumindest ein wenig und muss daher nicht lange um den heißen Brei reden. Ich wende mich also mir zu, einem großgewachsenen, freundlich dreinschauenden End-40er mit kurzen, grauen Haaren und einigen Kilos zu viel um die Mitte, und stelle die erste Frage:
Kannst Du Deine sexuelle Identität benennen?
Ja. (Fabian zögert ein wenig) Ich bin ein Mann, ein „Cis-Mann“.
Du zögerst dabei. Warum?
Weil es nicht so einfach ist. Auch mitten im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa. Es stimmt, Mann darf heute viel, wofür er vor 50 Jahren noch offen verlacht worden wäre. Manches davon wird noch immer verlacht, aber halt nicht offen oder nicht im 7. Bezirk. (Fabian grinst) Ein Aspekt der „klassischen“ Männlichkeit ist aber heute wie eh und je fix und – so erlebe ich es zumindest – untrennbar mit dem Attribut „Mann“ verbunden: die sexuelle Manneskraft und Standfestigkeit. Mann muss zumindest 1-2mal pro Woche ficken wollen – oder eigentlich andauernd und immer. Männlicher Sex ist Penetration mit dem Penis. Im besten Fall ist Ficken Teil von einem umfassenderen sexuellen Repertoire des „neuen (Super-)Mannes“. Darum habe ich gezögert bei der Frage, ob ich ein Mann bin. Denn das mit dem Ficken ist nicht meins…
Das heißt, du hast eine „erektile Dysfunktion“?
Es ist komplizierter als nur „keinen hochkriegen“… In meiner grundlegenden sexuellen Orientierung würde ich mich als Hetero bezeichnen. Vielleicht auch mit kurzem Zögern, weil es da schon zumindest andere Fantasien auch gibt. Aber wenn es darum geht, wo ich mich hingezogen fühle, dann sind das Frauen oder Menschen mit vorwiegend weiblichen Attributen. Ich finde Frauen* sexuell anregend, ja: erregend. Ich habe Lust, als Mann Frauen zu begegnen. Aber ich habe kein Interesse, sie mit meinem Penis zu ficken.
Kannst Du das genauer erklären? Was meinst Du dann mit „anregend“ und „erregend“?
Ganz konkret: Meine Frau ist ganz wunderbar. Ich finde sie wunderschön und habe starke sexuelle Gefühle für sie. Ich begehre sie! Aber nicht mit meinem Schwanz, sondern mit meinen Händen, meinem Mund, meiner Haut, meiner Nase, meinen Ohren. Ich will sie sehen, spüren, riechen, schmecken und hören. Wenn ich sie mit allen Sinnen wahrnehme und dabei auch noch ihre Erregung spüre, dann ist das wunderbarer Sex für mich. Dabei wird manchmal auch mein Schwanz hart. Aber selbst dann habe ich wenig Verlangen, sie zu ficken. Auch Blasen oder Handarbeit sind dann für mich eher „angenehm“ als „geil“. Ich strebe bei Sex auch kein „Kommen“ an und bin – wenn es schön war – nachher trotzdem vollkommen befriedigt. Dabei ist mein sexuelles Begehren keineswegs passiv. Im Gegenteil! Ich finde es wunderbar, meine Frau aktiv auf vielfältige Weise zu erregen und zu befriedigen, aber eben ohne Ficken.
Du sagst, dass Dein Schwanz „manchmal“ hart wird. Das heißt also, oft bleibt er schlapp. Ist Dein Des-Interesse daher nicht vielleicht in die Kategorie „saure Trauben“ einzuordnen? Weil es nicht geht, sagst Du Dir, dass Du eh gar nicht willst?
Das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber wenn, dann passiert das auf einer sehr tiefen, unbewussten Ebene. Denn es gibt mehrere Gründe, warum ich glaube, dass das nicht so ist. Am deutlichsten wird es, wenn ich pharmazeutische Unterstützung nutze. Da ich ja erregt bin und ich durchaus spontane Erektionen habe, „funktioniert“ das ganz gut. Dann gibt meine körperliche Kondition die Grenze vor, wie lange und ausgiebig ich ficken kann. Aber: mir bereitet das Geficke wenig Freude und es wird daher eher zum Stress für mich. Die blauen Pillen wirken, haben mir aber kein Wunder im Bett ermöglicht.
Zum anderen ist es so, dass ich auch angesichts von anderen Frauen, die mir gefallen, die ich „geil“ finde, nie das Bedürfnis oder die Fantasie habe, sie zu ficken. Auch dabei sind es Wünsche und Gedanken des Spürens, Küssens und so weiter. Und schließlich habe ich keinerlei Probleme, beim Wixen einen Steifen zu kriegen und zu kommen. Das ist aber eine ganz andere Qualität der sexuellen Befriedigung.
Hm, das klingt insgesamt jetzt so, als wäre Deine Sexualität zwar vielleicht nicht unbedingt das „Übliche“, aber doch schön und befriedigend, also alles im Lot. Ist das so?
Leider nicht ganz. Da ist zunächst mal bei mir das noch immer nicht abgeschüttelte Gefühl des Versagens, des Nicht-Normal-Seins. Ich werde andauernd und rundherum mit diesen Leistungsstandards der Männlichkeit konfrontiert. Jahrelang habe ich versucht, das „Defizit“ zu beheben, um normal zu „funktionieren“. Egal ob medizinische oder psychotherapeutische Hilfe, die Angebote gehen auch alle nur in die Richtung, die „Funktion“ wiederherzustellen. Keine einzige Ärztin* und kein einziger Therapeut* hat hinterfragt, was ich will und mit mir das Nicht-Wollen als valides Szenario entwickelt. Das musste ich selbst tun!
Klingt frustrierend.
Ist es auch. Und dann ist da meine Frau. Für die war das lange Zeit – und ist es wahrscheinlich noch – auch alles andere als leicht. Einerseits, ich kann es nachfühlen, ist ein schlapper Schwanz für sie zunächst einmal eine Kränkung. Denn auch für sie wirkt die gesellschaftliche Norm! ‚Wenn ein Mann mich nicht ficken will, dann bin unattraktiv für ihn‘, so oder so ähnlich kommt es für sie rüber. Da halfen lange Jahre alle Beteuerungen und alle „Taten“ der erotischen Wertschätzung wenig. Zudem wünscht sie sich schlicht, auch mal gefickt zu werden. Obwohl ich sie eh auf mehrere andere Arten zum Höhepunkt bringen kann, so ist dennoch die Sehnsucht bei ihr da, einen steifen Schwanz in sich zu spüren. Auch das kann ich nachvollziehen, ein schöner, steifer Schwanz ist etwas Geiles… Diesen Frust meiner Frau bekomme ich natürlich mit.
Autsch! Da wird es wohl auch so einiges an unerfreulicher Dynamik in der Beziehung geben?
Kann man sagen! Da ist zunächst mal die Frust-Dynamik: Es gab Zeiten, da wollte ich gar keinen sexuellen Kontakt mehr und bin teilweise jeder körperlichen Nähe aus dem Weg gegangen, nur um das Gefühl und das Erleben des „Versagens“ zu vermeiden. Was natürlich wieder meine Frau frustriert hat. Und damit wurde der von mir erlebte Druck noch größer…
Meine Frau hat darauf dann so reagiert, dass es für sie „ein guter Grund war“ fremdzugehen und sich den Sex woanders zu holen. Das ist über lange Jahre so gegangen. Bis sie sich mal in einen andern verliebt hat, was zu einer Beinahe-Trennung geführt und das Fremdgehen aufgedeckt hat.
Diese Verletzungen habe ich dann versucht therapeutisch aufzuarbeiten, aber – leider – immer mit dem Fokus auf das Herstellen einer „normalen“ Funktion.
Bis ich langsam selbst in eine Akzeptanz gefunden habe. Zumindest so halbwegs. Das hat dann viel offenere Gespräche ermöglicht. Weil ich ein paar Schritte raus bin aus dem Eck des „nicht Funktionierens“ und wir endlich über unser Wollen reden konnten und können. Ich meine echt und ehrlich und weniger belastet. Weil irgendwie haben wir ja eh immer geredet. Aber mit einem Fokus, der nicht hilfreich war.
Aktuell läuft der Versuch, in einer offenen Beziehung zu leben, die es meiner Frau ermöglicht, das zu bekommen, was ich ihr nicht geben kann und dennoch das wertzuschätzen, was wir miteinander haben.
Also doch eine positive Lösung am Ende?
Na ja, zumindest am Weg dahin. Was ich jedenfalls noch überwinden muss, ist das Versagens-Gefühl in der offenen Beziehung. Die erlebe ich derzeit noch ziemlich unausgewogen. Denn für eine Frau ist es offenbar recht leicht, Männer zu finden, die sie ficken und die ihr so Anerkennung und Bestätigung geben. Umgekehrt ist sehr schwer ist für mich, Frauen zu finden, die das suchen, was ich bieten kann: umfassende erotische Wertschätzung und intensive Befriedigung, nur halt ohne Ficken. Also etwas irgendwo zwischen Kuschel-Party und „klassischem“ Affären-Sex. Ich bekomme also bislang keine Anerkennung und Bestätigung… Bin ich wirklich so gut im Bett – mit meinem Repertoire? Kann ich andere Frauen auch so gut befriedigen, oder nur meine, weil wir uns halt schon lange kennen?
Und was natürlich weiter bestehen bleibt, ist der Druck gesellschaftlicher Normen. Der ist für mich spürbar auf so vielen Ebenen! Selbst bei meinen wirklich guten Freunden finde ich wenig Verständnis. Sie können mein Nicht-Können und vor allem mein Nicht-Wollen kaum nachvollziehen. Das geht weiter im Alltag mit jeder Menge zotiger Witze und Bemerkungen rundherum, mit Medien, Filmen, Serien und so weiter – unweigerlich wird immer Sex mit Ficken gleichgesetzt. Ein Thematisieren ist kaum möglich, ohne seltsame Reaktionen zu ernten. Ich fühle mich ziemlich allein…
Wie wird es für Dich weitergehen?
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich alles so ist, wie ich es derzeit erlebe. Vielleicht stimmt es ja, und es ist bei mir „bloß“ irgendwo ein Knick in meinen Kanälen der sexuellen Energie. Vielleicht schlummern aber auch noch ganz andere Sehnsüchte in mir, die ich bis jetzt noch nicht kenne.
Ich habe jedenfalls vor, meine sexuelle Identität, Orientierung und Energie weiter zu erforschen! Da kann dann noch einiges zu Tage treten. Es gibt so viele Formen und Ausprägungen von sexueller Freude. Manches ist de facto als „normal“ definiert, viel mehr aber entspricht nicht dieser Norm. Schön sein kann das eine wie das andere. Was klar ist: Für jeden Menschen ist – in mehr oder weniger großen Variationen – etwas anderes schön, befriedigend und erfüllend. Bei aller Unsicherheit, was ich an und in mir noch finden werde – ich freu mich drauf! Ich möchte Teil einer Vielfalt sein, die gefeiert wird!
Das klingt auch nach einem gesellschaftlichen Anliegen. Daher zum Schluss noch eine Frage: Du heißt nicht wirklich Fabian. Warum möchtest Du anonym bleiben?
Wenn es nur um mich ginge, wäre es mir egal, ja, würde ich sogar ganz bewusst mit meinem echten Namen hier erzählen. Aber da es auch um meine Frau geht und zumindest indirekt auch der Rest der Familie „seltsam“ angeredet werden könnte, bleibt es bei Fabian. Wer mehr wissen und mit mir in Kontakt treten will: fabian.ventura@gmx.at
Danke für das Selbst-Gespräch!
Danke , Fabian!! Wenn Ihr ebenfalls zu dieser Kategorie beitragen wollt und dazu beitragen wollt, ein vielseitigeres Bild von Sexualität zu vermitteln , freue ich mich über eine Nachricht hier.